Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union stehen 2024/2025 an einem entscheidenden Wendepunkt. Nach jahrelangen Verhandlungen haben Bern und Brüssel Ende 2024 ein neues Vertragspaket ausgehandelt, das die bilateralen Abkommen modernisieren und auf eine stabile Grundlage stellen soll (Quelle: Swissinfo).
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach anlässlich der Einigung vom 20. Dezember 2024 von einem „historischen Abkommen“ und einem „Tag der Freude“ (Quelle: NZZ).
Doch in der Schweiz selbst ist die Stimmung gespalten: Zwar gelten die bestehenden bilateralen Verträge mit der EU in der Bevölkerung als wichtig, aber eine begeisterte Aufbruchstimmung fehlt – viele Schweizerinnen und Schweizer begegnen dem europäischen Projekt mit einer gewissen Distanz (Quelle: SRF).
Einigung zwischen Schweiz und EU im Dezember 2024
Vertragspaket statt klassisches Rahmenabkommen
Ziel: Stabilisierung der bilateralen Beziehungen
Stimmung: Wichtige Einigung, aber verhaltene Begeisterung in der Bevölkerung
Nach jahrelangen Unsicherheiten und diplomatischem Stillstand ist es der Schweiz gelungen, mit der Europäischen Union ein neues Vertragspaket zu schnüren. Dieses soll die bilateralen Beziehungen sichern und gleichzeitig verhindern, dass die Schweiz zunehmend vom europäischen Binnenmarkt abgekoppelt wird. Trotz der erzielten Einigung bleibt die Stimmung im Land zwiespältig: Während Wirtschaft und Wissenschaft die Ergebnisse begrüßen, hegen Teile der Bevölkerung und verschiedene politische Lager weiterhin große Skepsis gegenüber einer stärkeren Anbindung an Brüssel.
Um die aktuelle Entwicklung zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück. Die Schweiz und die EU sind seit Jahrzehnten eng verflochten, allerdings ohne EU-Mitgliedschaft der Schweiz. Stattdessen regelt ein Geflecht bilateraler Verträge den Marktzugang und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen.
Nach dem EWR-Nein von 1992 schlug die Schweiz den „bilateralen Weg“ ein, beginnend mit den Bilateralen I (1999) und Bilateralen II (2004). Diese Verträge gewährleisten unter anderem:
Gegenseitiger Marktzugang (z. B. Personenfreizügigkeit, technischer Handel)
Kooperation im Schengen/Dublin-Raum
Anbindung an Forschung und Verkehr der EU
Allerdings geriet dieses Modell in den letzten Jahren unter Druck:
Die EU forderte eine institutionelle Lösung: automatische Übernahme neuer EU-Regeln, Streitbeilegung, Kontrolle.
Die Schweiz brach 2021 die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen ab, aus Sorge um Souveränität und Lohnschutz (Quelle: Swissinfo).
Folgen des Verhandlungsabbruchs:
Keine Aktualisierung bestehender Verträge mehr möglich
Erosion der Marktteilnahme (besonders bei Medtech-Branche sichtbar)
Kein Zugang zu Horizon Europe und anderen EU-Programmen
Die Notwendigkeit eines neuen Abkommens ergab sich also nicht aus Enthusiasmus, sondern aus ökonomischem Druck und der Vermeidung schleichender Isolation (Quelle: NZZ).
Die Bilateralen I und II prägten das Verhältnis der Schweiz zur EU über zwei Jahrzehnte hinweg und ermöglichten eine enge wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit ohne formelle EU-Mitgliedschaft. Doch neue Herausforderungen – etwa bei der Rechtsübernahme oder bei Streitbeilegungen – führten zu einem zunehmenden Reformdruck. Mit dem Verhandlungsabbruch 2021 wurde klar: Ohne eine neue Grundlage droht der Schweiz eine schleichende Erosion ihrer Marktzugangsprivilegien und ihrer Position innerhalb Europas. Die Zeit drängte.
✅ Ohne neues Abkommen drohte der Schweiz ein schrittweiser Marktzugang-Verlust
✅ Wirtschaft und Wissenschaft drängten auf eine Lösung
✅ Emotionale Skepsis der Bevölkerung gegenüber EU-Integration bleibt bestehen
✅ Ein neues Abkommen musste sowohl die EU als auch schweizerische Interessen berücksichtigen
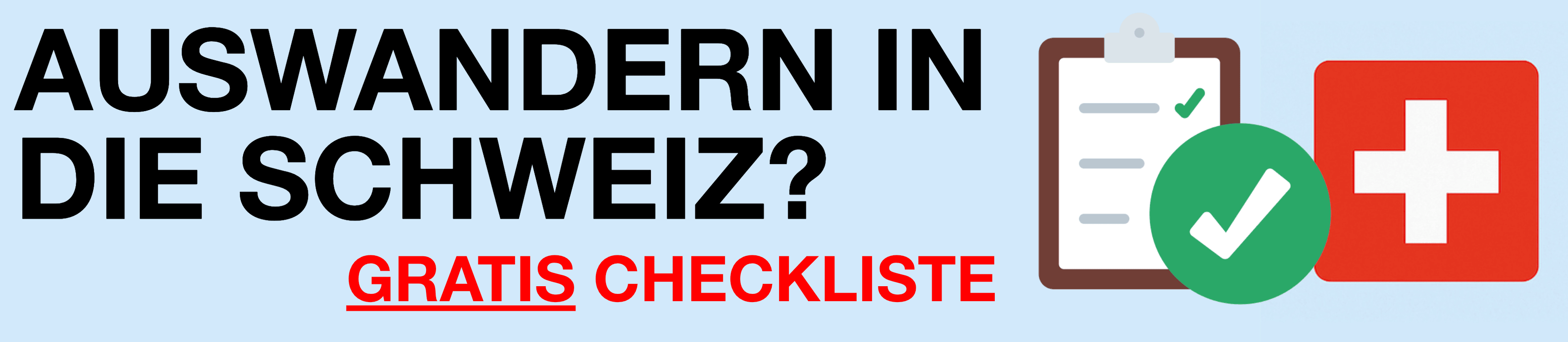
Nach einem langen diplomatischen Tauziehen begannen 2022 informelle Sondierungsgespräche.
Im Frühjahr 2024 erfolgte offiziell die Wiederaufnahme der Verhandlungen, und im Dezember 2024 kam es zur grundsätzlichen Einigung (Quelle: SRF).
Wichtigste Punkte der Einigung:
Integration institutioneller Regeln direkt in einzelne Fachabkommen
Drei neue Abkommen in den Bereichen Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Kompromisse bei Streitbeilegung (neues Schiedsgerichtssystem)
Wiederanbindung an Forschungs- und Bildungsprogramme
Begrenzte Übernahme von Beihilferegeln und dynamischen Anpassungen
✅ Ein Paket an mehreren Abkommen, kein klassisches Rahmenabkommen
✅ Beidseitige Kompromisse: Schweizer Lohnschutz bleibt erhalten, EU erhält Rechtssicherheit
✅ Volksabstimmung geplant: Voraussichtlich nicht vor 2027
Die Einigung zwischen der Schweiz und der EU basiert auf einem sogenannten Paketansatz, bei dem mehrere einzelne Abkommen modernisiert oder neu geschaffen werden. Ziel war es, sowohl Rechtssicherheit für Unternehmen zu schaffen als auch die Eigenständigkeit der Schweiz zu wahren.
Kernelemente des Abkommenspakets:
Institutionelle Regelungen direkt in die einzelnen Fachabkommen integriert (statt einheitlichem Rahmen)
Stromabkommen: Neu ausgehandelt, Zugang zum europäischen Strommarkt, Kooperation bei Versorgungssicherheit
Gesundheitsabkommen: Bessere Zusammenarbeit im Bereich Pandemiebekämpfung und Arzneimittelzulassung
Lebensmittelsicherheit: Angleichung der Schweizer Lebensmittelkontrollen an EU-Standards für erleichterte Exporte
Dynamische Rechtsübernahme: Neue EU-Regeln müssen von der Schweiz übernommen werden, aber mit politischem Einfluss
Streitbeilegung: Einführung eines unabhängigen Schiedsgerichtssystems statt automatischer Unterstellung unter den Europäischen Gerichtshof (EuGH)
Besonders heikel war die Frage nach dem Lohnschutz:
Hier konnten die Schweizer Verhandler durchsetzen, dass weiterhin besondere Schutzmechanismen für inländische Arbeitnehmer gelten, ein großer innenpolitischer Erfolg (Quelle: SRF).
Das neue Paket bringt einerseits Stabilität und Marktzugang für die Schweiz, andererseits mehr Rechtssicherheit für die Europäische Union. Die Schweiz verpflichtet sich zu einer moderaten dynamischen Übernahme von EU-Recht, erhält im Gegenzug Zugang zu essenziellen Programmen und sichert sich wichtige wirtschaftliche Vorteile. Gleichzeitig bleibt der Lohnschutz erhalten, und die Einführung eines unabhängigen Schiedsgerichts anstelle einer direkten EuGH-Unterstellung wird als großer Erfolg gewertet.
✅ Neue Abkommen: Strom, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit
✅ Bestehende Verträge modernisiert, inkl. Personenfreizügigkeit
✅ Souveränität bewahrt durch unabhängige Schiedsgerichtsbarkeit
✅ Keine automatische EuGH-Unterstellung, sondern eigenes Verfahren
✅ Lohnschutz bleibt bestehen – wichtiger innenpolitischer Erfolg

Viele Experten sehen den Abschluss als Erfolg für die Schweiz. Zwar gibt es Kompromisse, aber die wichtigsten Ziele wurden erreicht: wirtschaftlicher Zugang und politische Selbstbestimmung.
Vorteile im Überblick:
Marktzugang bleibt erhalten: Schweizer Firmen können weiterhin einfach in der EU Handel treiben
Forschungsprogramme: Schweiz wird wieder vollwertiges Mitglied bei Horizon Europe und Erasmus+
Stromsicherheit: Einbindung in die europäische Netzplanung verbessert die Versorgungssicherheit
Planungssicherheit: Unternehmen erhalten stabile Rahmenbedingungen, Investitionen werden erleichtert
Lohnschutz und Sozialschutz: Schweizer Standards bleiben weitgehend bestehen
(Quelle: EU-Kommission, Swissinfo)
Auch die Wirtschaft hat klar signalisiert, dass sie das neue Paket unterstützt. Der Wirtschaftsdachverband economiesuisse etwa sprach von einem „wichtigen Schritt für den Wohlstand des Landes“ (Quelle: NZZ).
Wirtschaftlich bringt der Deal der Schweiz enorme Vorteile: Der einfache Zugang zum europäischen Markt bleibt bestehen, und Schweizer Unternehmen müssen keine neuen Handelshemmnisse befürchten. Auch die Rückkehr zu Forschungs- und Bildungsprogrammen wie Horizon Europe oder Erasmus+ wird die Innovationskraft stärken. Darüber hinaus sorgt die Kooperation im Stromsektor für eine verbesserte Versorgungssicherheit, gerade in Zeiten wachsender Energiekrisen.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Kritiker warnen vor einer schleichenden Abhängigkeit von Brüssel. Die dynamische Rechtsübernahme könnte langfristig dazu führen, dass Schweizer Interessen zu wenig Gehör finden. Auch das neue Schiedsgericht, obwohl als Kompromiss präsentiert, stößt nicht überall auf Begeisterung. Die Angst vor einem schleichenden Verlust an demokratischer Kontrolle ist präsent – und könnte bei der geplanten Volksabstimmung entscheidend werden.
Trotz der vielen Vorteile sehen zahlreiche Stimmen auch Risiken und Nachteile im neuen Abkommen. Gerade aus konservativen und unabhängigen Kreisen wird Kritik laut.
Hauptkritikpunkte:
Dynamische Übernahme von EU-Recht: Viele fürchten eine schleichende Aufgabe der schweizerischen Eigenständigkeit, da neue EU-Gesetze künftig übernommen werden müssen, wenn auch mit Mitspracherecht.
Schiedsgericht statt EuGH: Auch wenn die Schweiz sich nicht direkt dem EuGH unterwirft, könnte die Auslegung von Streitfällen EU-lastig sein (Quelle: NZZ).
Beihilferegeln: Die Schweiz verpflichtet sich, künftig staatliche Subventionen strenger zu kontrollieren. Manche Experten warnen, dies könne die wirtschaftliche Flexibilität der Schweiz beeinträchtigen (Quelle: Swissinfo).
Fremdbestimmung durch EU-Dynamik: Kritiker wie die SVP warnen vor einem Verlust demokratischer Kontrolle (Quelle: SRF).
Ein weiteres Streitthema ist die geplante Umsetzung:
Volksabstimmung nötig: Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Abkommen in der Schweiz dem Volk vorgelegt wird. Beobachter rechnen mit einer Abstimmung frühestens 2027 oder 2028.
Gefahr eines erneuten Neins: Sollte das Schweizer Volk den Deal ablehnen, droht eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zur EU, ähnlich wie beim EWR-Nein 1992.
❗ Übernahme von EU-Recht könnte Souveränität beeinträchtigen
❗ Risiko EU-lastiger Streitbeilegung trotz Schiedsgericht
❗ Einschränkung bei Subventionen möglich
❗ Politische Sprengkraft bei einer zukünftigen Volksabstimmung
Wenn der Vertrag in Kraft tritt, ändert sich einiges für Schweizer Bürger und Unternehmen:
Stabiler Zugang zum europäischen Binnenmarkt bleibt bestehen
Mehr Kooperation im Strom- und Gesundheitsbereich
Rückkehr zu wichtigen Forschungsprogrammen wie Horizon Europe
Modernisierung bestehender Abkommen, z. B. Personenfreizügigkeit
(Quelle: EU-Kommission, Swissinfo)
Besonders wichtig: Viele der bisherigen Unsicherheiten (z. B. bei Exportzertifikaten, wissenschaftlicher Zusammenarbeit) würden durch den Abschluss beseitigt werden.
Aber: Das politische Risiko bleibt hoch. Die Diskussion über Souveränität und die Unabhängigkeit der Schweiz wird urch den neuen Deal nicht enden – sondern möglicherweise sogar verstärkt (Quelle: SRF).
In der Praxis bedeutet der Deal Stabilität, aber auch neue Verpflichtungen. Unternehmen können weiterhin reibungslos mit der EU wirtschaften, und die Teilnahme an europäischen Programmen bietet enorme Chancen. Gleichzeitig müssen Schweizer Behörden und Bürger auf neue Regeln reagieren und flexibler werden. In vielen Bereichen wird die Schweiz stärker in den europäischen Rechtsraum eingebunden sein als bisher – ein Balanceakt zwischen Eigenständigkeit und wirtschaftlichem Nutzen.
Was bringt der Deal?
Stabilisierung der Wirtschaftsbeziehungen
Erhalt des Marktzugangs für Unternehmen
Wiederanbindung an Horizon Europe und Erasmus+
Bessere Versorgungssicherheit beim Strom
Sicherung des Schweizer Lohnschutzes
Wo liegen die Risiken?
Teilweise Übernahme von EU-Recht
Kritische Diskussion um Verlust der Souveränität
Politische Unsicherheit durch geplante Volksabstimmung
Was passiert als Nächstes?
2025/2026: Interne Vernehmlassung und parlamentarische Beratung
Frühestens 2027: Volksabstimmung möglich
Danach: Ratifizierung und Umsetzung in nationale Gesetze
Der neue Vertrag zwischen der Schweiz und der EU ist ohne Zweifel ein Meilenstein. Nach Jahren des Stillstands bringt das Abkommen wieder Bewegung in die Beziehungen – mit allen Chancen und Risiken.
Die wichtigsten Erkenntnisse:
Der Marktzugang für Schweizer Unternehmen bleibt erhalten
Die Schweiz erhält wieder vollen Zugang zu wichtigen Programmen wie Horizon Europe
Die Souveränität wird durch neue Streitbeilegungsmechanismen gewahrt, aber der Einfluss der EU auf das schweizerische Recht wird steigen
Eine Volksabstimmung wird entscheiden, ob der Vertrag wirklich Bestand haben wird
Experten wie Michael Ambühl, ehemaliger Staatssekretär und Professor an der ETH Zürich, ordnen den Deal nüchtern ein:
„Es ist ein realistischer Kompromiss. Kein Triumph für die Schweiz, aber ein dringend notwendiger Schritt, um eine schleichende Isolation zu verhindern.“
(Quelle: NZZ)
Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lobte den Vertrag als „Beweis dafür, dass Partnerschaft auch ohne Mitgliedschaft möglich ist“ (Quelle: SRF).
✅ Der neue EU-Deal sichert wirtschaftliche und wissenschaftliche Kooperationen
✅ Politisch bleibt die Lage heikel – eine Volksabstimmung könnte alles kippen
✅ Die Schweiz verteidigt wichtige nationale Interessen, macht aber auch Zugeständnisse
✅ Der Vertrag ist ein Balanceakt zwischen Unabhängigkeit und europäischer Integration
Holen Sie sich jetzt Ihre Gratis-Checkliste für die Auswanderung in die Schweiz
Vertiefen Sie Ihr Wissen mit dem umfassenden Handbuch "Chancen in Europa"
Entdecken Sie noch mehr hilfreiche Infos in unserem Blog rund um das Leben in der Schweiz
Bleiben Sie informiert. Planen Sie klug. Und gestalten Sie Ihre Zukunft!
BLOG DURCHSUCHEN
WEITERE BLOGARTIKEL
Handbuch
"Chancen in Europa"
Ihre Anleitung für ein Leben in der Schweiz
Werden Sie zum Schweiz Insider
© The Wellington Consulting Ltd